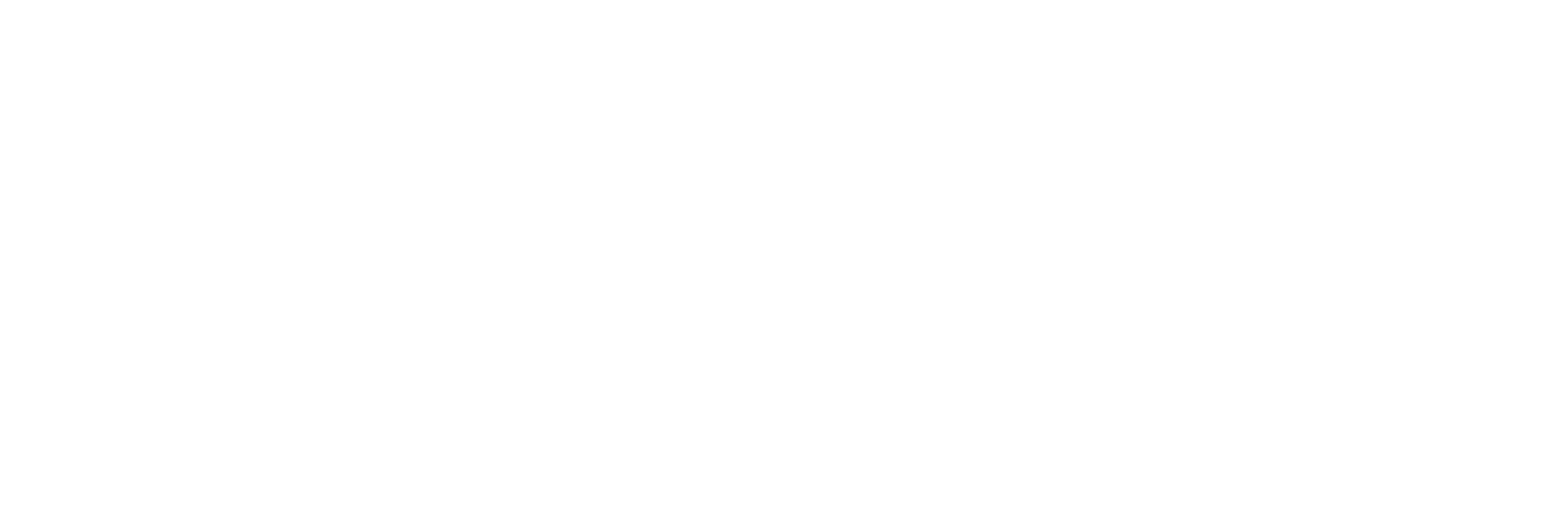Beurteilungskriterien
Die Bibel der Gutachter und der Vorbereiter!

Hier erklären wir Dir, was es mit den geheimnisumwobenen Buch "Beurteilungskriterien, Urteilsbildung in der Fahreignungsbegutachtung" auf sich hat und warum es für Gutachter als auch für Vorbereiter eine Art Bibel darstellt.
Inhaltsverzeichnis

Einführung in die BuK
Das Buch "Beurteilungskriterien, Urteilsbildung in der Fahreignungsbegutachtung" (BuK) ist ein offizielles Handbuch, das von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) herausgegeben wird. Es enthält die offiziellen Beurteilungskriterien und Empfehlungen für die Durchführung der medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU) in Deutschland.
Das Handbuch ist eine wichtige Informationsquelle für MPU-Gutachter und Verkehrsbehörden, um sicherzustellen, dass die MPU-Verfahren und -Kriterien standardisiert und objektiv durchgeführt werden. Es gibt detaillierte Informationen zu den verschiedenen Aspekten der MPU, einschließlich der medizinischen Untersuchungen, psychologischen Tests, Verkehrsbezogenen Fahrens, Sozialverhaltens und Prognosen.
Die aktuelle Version ist die 4.0. Weiter unten sind die wichtigsten Änderungen zur dritten Edition aufgeführt.
Das Buch ist auch für Kandidaten, die sich auf die MPU vorbereiten, von Interesse, da es ihnen einen Überblick über die Beurteilungskriterien und Anforderungen gibt, die bei der MPU-Untersuchung berücksichtigt werden. Allerdings empfiehlt sich die Lektüre nur als Ausgangspunkt. Kein Kandidat wird nach dem Lesen eine MPU bestehen können, denn es werden lediglich die Kriterien aufgeführt und keine Antworten!
Insgesamt ist das Buch "Beurteilungskriterien, Urteilsbildung in der Fahreignungsbegutachtung" ein wichtiger Leitfaden für alle, die eine MPU begutachten oder ihre Klienten auf eine solche vorbereiten möchten.
Hier siehst Du mal ein Teil des Inhaltsverzeichnis der BuK. Dort findest Du die gebräuchliche Aufteilung der möglichen Gründe für eine MPU: A für Alkohol, D für Drogen, V für Verkehrsauffälligkeit und Strafen, M für Medikation und weitere:
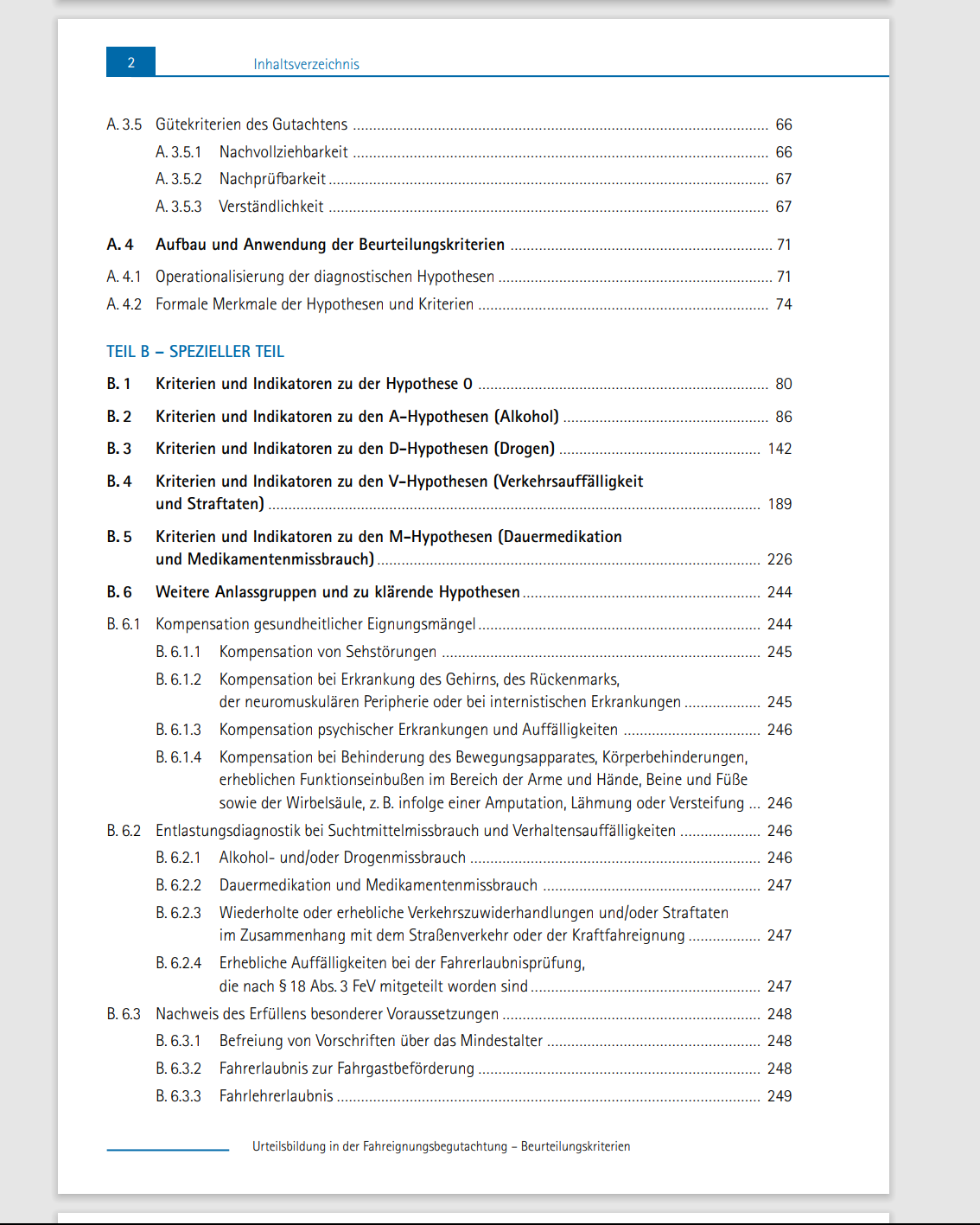
Wie funktionieren die Beurteilungskriterien?
Was bedeutet das nun alles?
Nehmen wir das Beispiel Alkohol. Eine Person wurde die Fahrerlaubnis wegen Alkohol am Steuer entzogen und muss nun eine MPU machen. Diese Person stellt nun einen Antrag bei der Behörde und bekommt daraufhin ein Schreiben, in welchem die Behörde eine Frage in den Mittelpunkt rückt. Dies ist die Fragestellung. Sie könnte in etwa so lauten: Ist zu erwarten, dass die Person A in Zukunft das Trinken von Alkohol und das Fahren im Straßenverkehr trennen kann?
Jeder Gutachter versucht genau diese Fragestellung zu beantworten. Dazu schaut er sich die Akte der Person an und formuliert für sich eine sogenannte Hypothese, auf Grundlage der Beurteilungskriterien und des Schweregrades des Problems oder der Delikte.
Zum Beispiel könnte er auf folgende Hypothesen zurückgreifen:
Hypothese A2: Der Klient ist nicht dauerhaft in der Lage, mit Alkohol kontrolliert umzugehen. Er verzichtet deshalb konsequent, zeitlich unbefristet und stabil auf den Konsum von Alkohol.
oder
Hypothese A3: Es lag eine Alkoholgefährdung vor, die sich in gesteigerter Alkoholgewöhnung, unkontrollierten Trinkepisoden oder ausgeprägtem Entlastungstrinken äußerte. Der Klient hat aufgrund eines angemessenen Problembewusstseins sein Alkoholtrinkverhalten ausreichend verändert, so dass von einem dauerhaft kontrollierten Alkoholkonsum ausgegangen werden kann.
Der Gutachter hat sich aufgrund der Aktenlage ein Bild gemacht und kommt zu dem Schluss, dass zum Beispiel in einem Fall die Hypothese A3 zutrifft. Wie kommt er dazu? Hier kommen die Kriterien ins Spiel! Es gibt für die Hypothesen jeweils Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit die Hypothese zutrifft. Zum Beispiel wäre eines der Kriterien, damit die Hypothese A3 erfüllt wird: A 3.1 K - Es lagen eine überdurchschnittliche gesteigerte Alkoholtoleranz und/oder unkontrollierte Trinkepisoden vor.
Manchmal ist diese Einordnung oder Erkennung nicht allein aus der Akte ersichtlich. Dann bildet sich der Gutachter während der Prüfung die Hypothese. Anderweitig gibt es auch Fälle, wo es sofort ersichtlich ist, welche Hypothese formuliert werden muss, da externe Gutachten bereits Diagnosen vollzogen haben, was bei einer Sucht wie der Alkoholabhängigkeit der Fall wäre.
Diese "Erkennungskriterien" müssen erfüllt sein, damit die jeweilige Hypothese zutrifft. Wenn das der Fall ist, hat man die Hypothese und zugleich das Problem, welches es zu bewältigen gilt. Und nun gibt es für dieses Problem ebenso Kriterien, die es gilt zu bewältigen, damit man die Prüfung besteht. Diese Kriterien heißen treffenderweise auch Problembewältigungskriterien, welche zahlreich und mit vielen Unterpunkten auftauchen können. Hat man den Prüfer davon überzeugt, dass man alle anfallenden Problembewältigungskriterien erfüllt, besteht man die Prüfung!
4.0 - die neuste Auflage und ihre wichtigsten Änderungen
Hier das offizielle Statement vom Kirschbaumverlag (Verleger des Buches) zu den Änderung im Vergleich zur dritten Auflage:
Seit der dritten Auflage der Beurteilungskriterien (2013) haben sich in den relevanten fachlichen Grundlagen, in der wissenschaftlichen Diskussion und in der Rechtsprechung eine Vielzahl von Entwicklungen ergeben. Auch aus der ärztlichen, psychologischen, toxikologischen und verwaltungsrechtlichen Praxis sind wertvolle Anregungen und Hinweise hinzugekommen.
Insbesondere waren im Zuge der 4. Auflage zu berücksichtigen:
- wichtige Impulse aus den Diskussionen von Expertengruppen zu Dauermedikation sowie Alkohol-/Drogen- und Arzneimittelmissbrauch sowie überarbeitete und neue S3-Leitlinien in diesen Bereichen,
- die neue Sichtweise des DSM-5® auf substanzbezogene Störungen mit dem Wegfall der diagnostischen Kategorie „Substanzmissbrauch“ (grundsätzliche Anpassung d.er A- und D-Hypothesen), Kriterium
- die aktuelle Rechtsprechung zum Trennverhalten bei Cannabiskonsumenten,
- die Einordnung neuer Risikophänomene bei Verkehrsauffälligen, wie Rasern und Posern, in die Struktur der V-Kriterien. Berücksichtigung von mangelnder Impulskontrolle und aggressivem Verhalten neben den verschiedenen Graden von Anpassungsproblemen.
- Neu aufgenommen wurden auch Eignungsaspekte einer Dauermedikation mit fahrsicherheitsrelevanten Arzneimitteln sowie die spezifischen Folgen von Medikamentenmissbrauch oder Arzneimittelabhängigkeit (neue M-Kriterien).
Die methodischen Kapitel (Hypothesen PUG, MFU, CTU und PTV) wurden durchweg aktualisiert, die PUG- und CTU-Kriterien dabei grundlegend überarbeitet. So wurden etwa Erläuterungen der Methoden zur Verhaltensanalyse und Veränderungsdiagnostik hinzugefügt. Hinsichtlich der toxikologischen Befunde zur Abstinenzkontrolle werden mit der Einführung der PEth-Bestimmung und einheitlicher Cut-off -Werte neue Wege aufgezeigt. Zudem werden die Erkenntnisse über angemessene professionelle Betreuung und Therapie auffälliger Verkehrsteilnehmer dargestellt und Kriterien daraus abgeleitet (FFI-Kriterien). Um dies alles für die Anwender leichter auffindbar zu machen, wurden die Beurteilungskriterien mit der 4. Auflage neu gegliedert.
Das Werk richtet sich primär an die medizinischen und psychologischen Gutachter:innen sowie an alle, die im Bereich der Rehabilitation tätig sind. Aber auch Verwaltungsbehörden und Jurist:innen finden hierin eine wertvolle Hilfe bei der Bewertung von Fahreignungsfragen.